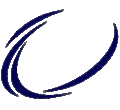Der Vorgänger der Berliner Thesen - wenn ich das so sagen darf - die Seelisberger Thesen von 1947 entstanden unter dem unmittelbaren Eindruck vom Grauen des Holocaust. Sie markierten den Beginn einer notwendigen Aufräumarbeit in der kirchlichen Lehre. Sie begannen mit theologischen Aussagen, die den Antijudaismus in seiner Absurdität entlarvten.
Dass ein und derselbe Gott durch das Alte und das Neue Testament zu uns allen spricht, dass Jesus und seine ersten Jünger Juden waren, dass die Passionsgeschichte und die Rolle der jüdischen Beteiligten differenziert zu betrachten sind - all das, all die Aussagen von Seelisberg sind heute in der christlichen Welt weitgehend Konsens.
Ohne Frage: Es gibt leider auch christliche Strömungen, die sich diesem Konsens nach wie vor verschließen. Deshalb greifen die Berliner Thesen die Themen von Seelisberg auf. Aber sie gehen weit darüber hinaus.
Die Berliner Thesen würdigen, was erreicht wurde. Sie richten sich explizit an christliche und jüdische Gemeinden. Sie benennen konkrete Aufgaben und Zielen für die kommenden Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte. Und sie erweitern den Blick vom christlich-jüdischen Dialog ausgehend auf das Gespräch mit Muslimen. All das halte ich für richtig. Und ich bin sehr dankbar für Ihre Arbeit. Sie haben damit entscheidende Weichen für die Zukunft des christlich-jüdischen Dialogs gestellt. Dessen bin ich gewiss.
Wie sieht die Zukunft des christlich-jüdischen Dialogs aus? Das ist die Frage, die Sie mir für meine kurze Rede gestellt haben. Ich muss Sie enttäuschen: Ich weiß es nicht.
Wer vermag schon präzise Auskunft über die Zukunft zu geben? Selbst die Propheten nutzten in der Regel Bilder und Metaphern für ihre Ankündigungen. Ganz aktuell erinnere ich an die Finanzmarktkrise. Zwar warnten vereinzelte Stimmen schon lange vor einem nahenden Zusammenbruch der Kredit- und Geldwirtschaft. Aber konkret hat die Finanzmarktkrise in ihren Ausmaßen wohl niemand vorhergesehen. Sie hat uns überrascht und manche Ziele und Pläne zurückstellen lassen. Andere Vorhaben sind in den Vordergrund gerückt.
Wie die Zukunft konkret aussehen wird, das lässt sich nicht sagen. Das ist wie beim Rudern. Wir schauen auf das, was hinter uns liegt. Der Blick in Fahrtrichtung aber ist versperrt. Vereinzelt mag es Steuermänner und -frauen geben. Aber ihr Urteil allein treibt uns kaum voran.
Die Kraft, in die Riemen zu greifen und Richtung Zukunft zu rudern, die entspringt in erster Linie zwei anderen Quellen.
Die eine Quelle ist die Erfahrung, die Grundeinstellung, die Lebensweisheit. Ruderer orientieren sich auch an markanten Orten, die sie bereits passierten. Besonders herausragend und noch weit sichtbar sind übrigens in der Regel religiöse Gebäude - in Deutschland ganz überwiegend Kirchen. Sie können Halt und Orientierung bieten.
Die zweite Quelle für die Kraft zum Vorausrudern sind Hoffnungen und Ziele. Es gibt in der Regel eine Idee, wohin die Reise gehen soll. Hoffnungen und Ziele verbinde ich selbstverständlich auch mit dem christlich-jüdischen Dialog:
Ich will, dass er weiter dazu beiträgt, Diskriminierung und Vorurteile abzubauen. Ich will, dass er eine Basis bleibt, auf der strittige Fragen und Probleme sachlich erörtert werden können. Dass das notwendig ist, zeigt sich immer wieder. Wenn ich darüber hinaus an den interreligiösen Dialog insgesamt denke, dann will ich, dass er Folgendes bewirkt:
Erstens: Niemand soll sich auf die Religion berufen können, um Gewalt zu legitimieren.
Zweitens: Ich will, dass das Gespräch über Religions- und Kulturgrenzen hinweg Konflikte verhindert bzw. bestehende Auseinandersetzungen entschärft. Streit gehört dazu. Aber der Streit darf niemand an Leib und Seele verletzen.
Drittens: Ich will, dass die Idee von Freiheit in Verantwortung, von Brüderlichkeit und Nächstenliebe weitergetragen wird.
Und das alles ließe sich summieren in dem Ziel, friedlich miteinander zu leben. Den Weg dahin haben Sie in den vergangenen Jahrzehnten vorgezeichnet. Um noch einmal das Bild des Ruderes aufzunehmen: Ihr Riemenschlag ist der Handschlag. Die Methode des christlich-jüdische Dialogs sind die Begegnung und das Gespräch von Mensch zu Mensch - eine Begegnung und ein Gespräch ganz im Sinne Martin Bubers.
Er war davon überzeugt: „Die Hauptvoraussetzung zur Entstehung eines echten Gesprächs ist, dass jeder seinen Partner als diesen, als eben diesen Menschen meint.“ Das Gegenüber muss nach Martin Buber stets als Du wahrgenommen werden und keinesfalls als ein Es.
Daran hat ja auch die Kirche über Jahrhunderte gekrankt: Dass sie über Juden sprach, lehrte und urteilte anstatt mit ihnen zu reden und zu lernen. Der Weg zu einem guten Miteinander führt über den Dialog. Ein gutes Gespräch besteht dabei zur Hälfte aus Zuhören. Das erfordert den Willen zum Verstehen. Das erfordert das Hineinversetzen in den anderen. Und das erfordert das Durchdenken der verschiedenen Argumente. Zuhören ist eine Kunst.
Die Gesprächspartner müssen zudem wissen, worüber sie reden. Sie sollten sich ihres eigenen Standpunkts klar sein. Noch einmal in den Worten Martin Bubers: „Um zum Andern ausgehen zu können, muss man bei sich gewesen sein, bei sich sein.“
Die Religion gehört zu den heikelsten Themen eines Gesprächs. Sie berührt die Menschen in ihrem Innersten. Jede Frage zielt in letzter Konsequenz auch auf das Selbstverständnis des Gegenübers. Das stellt den interreligiösen Dialog vor Herausforderungen. Zugleich zeigt sich an diesem Punkt die Bedeutung des interreligiösen Dialogs. Gerade weil die Religion so stark die Person bestimmt, können falsche theologische Aussagen verheerend wirken. Das war und ist das Problem des Antijudaismus. Das betrifft aber auch islamische Lehren über Christen und Juden.
Und noch ein weiterer Aspekt macht den interreligiösen Dialog zu einer heiklen Angelegenheit. Dem Gespräch sind Grenzen gesetzt, die es zu akzeptieren gilt. Letzlich bleiben auch Fragen an die Religion des Anderen offen. Denn nur durch den Glauben selbst erschließt sich die ganze Dimension. Keiner außerhalb des Judentums kann es ganz verstehen. Keiner außerhalb des Christentums kann es ganz verstehen. Und keiner außerhalb des Islam kann ihn ganz verstehen.
Diese Grenze zu akzeptieren, fällt vielleicht manchmal schwer. Sie bewahrt aber auch davor, alles in eins zu kehren. Glaubensinhalte zu verstecken oder sich über die Verschiedenheit einfach hinwegzusetzen und quasi Übereinstimmung zu erschleichen, das birgt neue Gefahren. Das kann den Blick auf die Kernfragen verstellen und damit ihrer Lösung im Weg stehen. Die Unterschiede, die bestehen, gilt es zu akzeptieren und nicht zu verwischen.
Meine Damen und Herren, ich empfinde eine hohe Achtung vor der Aufgabe, der Sie sich stellen. Sie haben in den vergangenen Jahrzehnten viel bewirkt. Das ist im Miteinander zwischen Christentum und Judentum heute spürbar - trotz bleibender Herausforderungen. Ihre Berliner Thesen zeugen davon.
Ihre Thesen tragen den Namen der Stadt, von der aus während des Nationalsozialismus die Verfolgung und Ermordung der Juden Europas organisiert wurde. Das ist eine besondere Verpflichtung und eine besondere Ehre.
Unser Land hat sich verändert. Unser Land hat aber nicht vergessen. Die Erinnerung an die Greueltaten des Nationalsozialismus und das Grauen der Shoa haben ihren festen Platz in unserem Gedächtnis. Das spiegelt sich in zahlreichen Orten des Gedenkens wieder. Sie waren heute Nachmittag am Denkmahl für die die ermordeten Juden Europas. Das ist nur ein Beispiel.
Das Bild vom Ruderboot, es hat ja bereits deutlich gemacht: Alles, was auf uns zukommt, beurteilen wir auch vor dem Hintergrund unserer Geschichte und unserer Erfahrungen. Zusammen mit den Grundwerten und -überzeugungen sind sie der Kompass für neue Ziele.
So bestimmen die Vergangenheit und der Umgang mit ihr unsere Zukunft.
Das Erinnern an die Shoa und ihre Opfer schafft eine hohe Sensibilität dafür, wie gefährdet Freiheit und Demokratie sind. Das Erinnern kann vor Überheblichkeit bewahren. Aber es fordert auch Engagement heraus – für ein friedliches Zusammenleben. Dessen ist sich unser Land sehr bewusst.
Daran haben auch der Deutsche Koordinierungsrat und seine Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit erheblichen Anteil. Dass Sie, liebe Gäste, Berlin für Ihre Jahreskonferenz gewählt haben, ist ein schöner Dank für ihr größtes Einzelmitglied. Sie haben gestern sogar alle zusammen das 60jährige Bestehen des Deutschen Koordinierungsrates gefeiert. Und ich kann mich der Bundeskanzlerin in ihrem Lob für die Arbeit der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit nur anschließen.
Ich bin dankbar, dass so aufmerksam auf Deutschland und seinen Wandel geschaut wird. Jüngst hat US-Präsident Obama mit seiner Rede in Buchenwald und seinem Respekt für die Aufarbeitung der Vergangenheit in Deutschland viel Aufsehen erregt. Solche Wort ermutigen hierzulande viele in ihrem Engagement.
Meine Damen und Herren: Regen lässt das Gras wachsen, Wein das Gespräch. Erheben Sie mit mir das Glas: Auf die vergangenen Tage in Berlin! Auf das, was Sie in den Jahrzehnten Ihrer Arbeit erreicht haben! Und wenn ich an die Zukunft denke, dann will ich beim Bild vom Wassersport bleiben und sagen: Volle Kraft voraus!